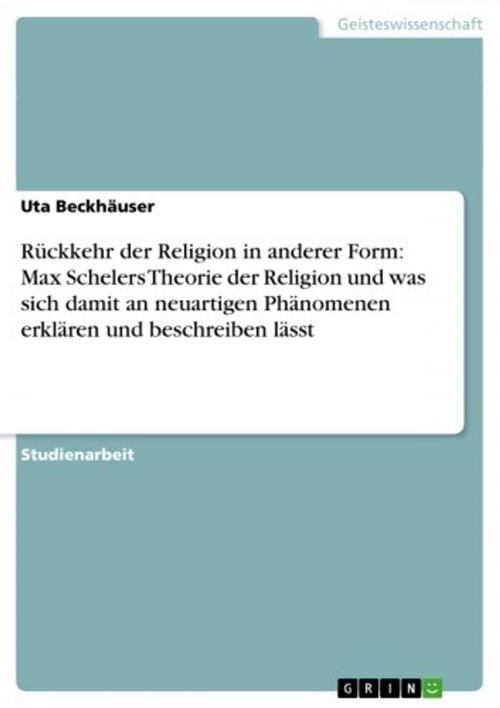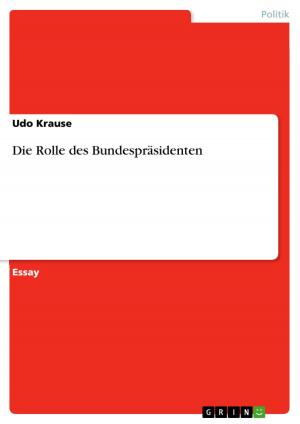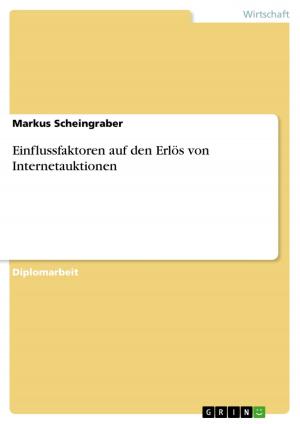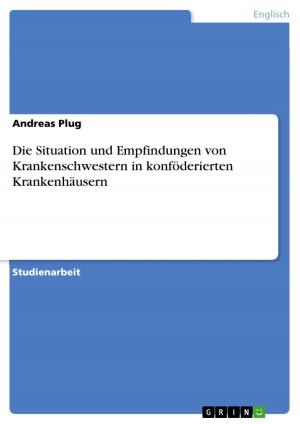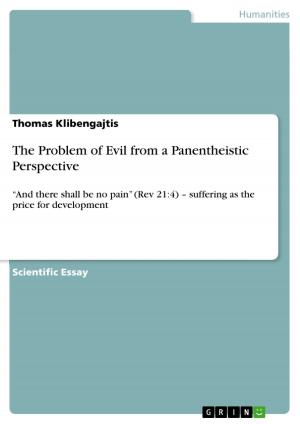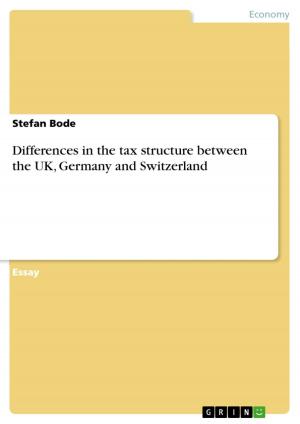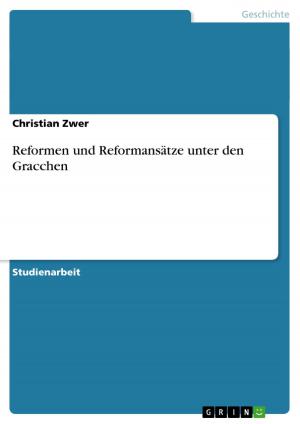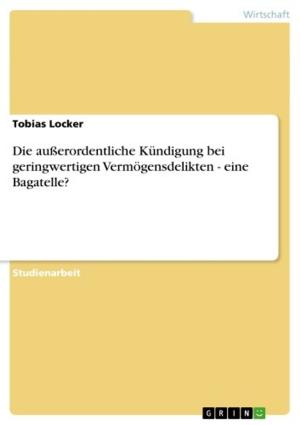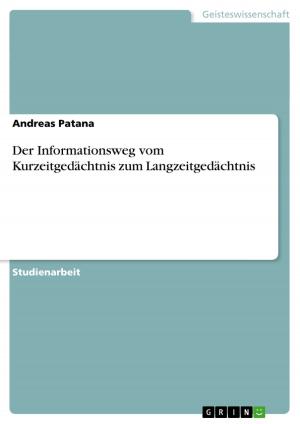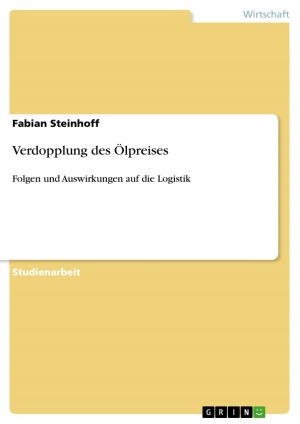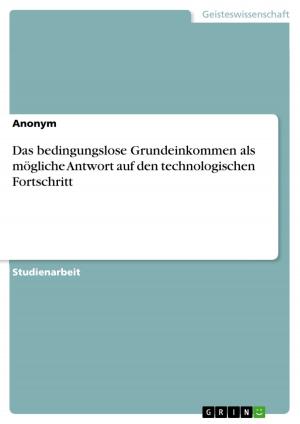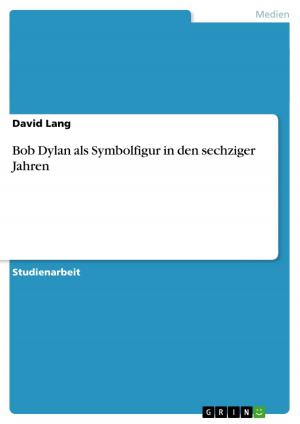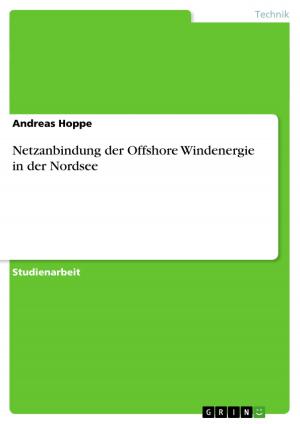Rückkehr der Religion in anderer Form: Max Schelers Theorie der Religion und was sich damit an neuartigen Phänomenen erklären und beschreiben lässt
Nonfiction, Social & Cultural Studies, Social Science, Sociology, Marriage & Family| Author: | Uta Beckhäuser | ISBN: | 9783638015912 |
| Publisher: | GRIN Verlag | Publication: | March 4, 2008 |
| Imprint: | GRIN Verlag | Language: | German |
| Author: | Uta Beckhäuser |
| ISBN: | 9783638015912 |
| Publisher: | GRIN Verlag |
| Publication: | March 4, 2008 |
| Imprint: | GRIN Verlag |
| Language: | German |
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Soziologie - Religion, Note: 1,3, Technische Universität Dresden (Institut für Soziologie), Veranstaltung: Max Scheler, 14 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Vor über zweitausend Jahren kam ein Denken auf, das die Menschen bis heute wie nie zuvor in ihren Bann zog. Es entstand, aus und neben dem Judentum und neben dem Islam, eine der größten monotheistischen Weltreligionen: das Christentum. Nie wieder sollte eine Religion so viele Menschen vereinen; heute zählt man etwa 1,8 Milliarden Christen. Ihr Stifter, Jesus von Nazareth, predigte Nächstenliebe und kündigte das Reich Gottes an. Seit jeher beschäftigt sich der Mensch mit seinesgleichen. Er fragt nach seiner Herkunft und seiner Bestimmung ebenso wie nach einem Sinn des Lebens und seinem Platz in diesem. Die Religion versucht, diese elementaren Fragen zu beantworten und somit den Menschen das Leben leichter, ja erträglicher zu machen. Schon im alten Testament, der gemeinsamen Quelle von Judentum und Christentum, versuchte man den Menschen zu verorten, ihm eine besondere Position zukommen zu lassen. Er gilt als Krone der Schöpfung, ist nach dem Bilde Gottes geschaffen und hat einen Herrschaftsauftrag über die Schöpfung, über alle Tiere, über Land (und alles was darauf wächst) verliehen bekommen. Kant bezeichnete die Frage, 'Was ist der Mensch?', sogar als eine der vier Grundfragen der Philosophie. Die Wurzeln einer solchen Fragestellung kann man folglich schon viel früher in der Geschichte finden, vor dem Entstehen des Christentums. Aristoteles war der erste, der das Menschsein von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtete, obwohl das Wort Anthropologie in der Antike noch nicht bekannt war. Er definierte den Menschen als vollkommenstes aller Lebewesen und sah seine Sonderstellung in der Sprache und der Vernunft begründet (ebenso waren das Lachen und der aufrechte Gang spezifisch menschliche Eigenschaften). Diese Auffassung prägte das christliche Mittelalter entscheidend. Henri Bergson fasste den Menschen als homo faber auf, also als ein Wesen, welches seine Umwelt durch seine Fähigkeiten unter Kontrolle hat (vgl. Scheler 1914: 340). Der Philosoph und Soziologe Max Scheler sieht jedoch im homo faber nur einen Menschen zweiter Klasse. Obwohl schon zu Lebzeiten in der philosophisch interessierten Öffentlichkeit enorm anerkannt - Heidegger bezeichnete ihn als die stärkste philosophische Kraft der Gegenwart - galt Scheler auf seinem Gebiet immer als Philosoph zweiter Wahl (vgl. Sander 2002: 9).
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Soziologie - Religion, Note: 1,3, Technische Universität Dresden (Institut für Soziologie), Veranstaltung: Max Scheler, 14 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Vor über zweitausend Jahren kam ein Denken auf, das die Menschen bis heute wie nie zuvor in ihren Bann zog. Es entstand, aus und neben dem Judentum und neben dem Islam, eine der größten monotheistischen Weltreligionen: das Christentum. Nie wieder sollte eine Religion so viele Menschen vereinen; heute zählt man etwa 1,8 Milliarden Christen. Ihr Stifter, Jesus von Nazareth, predigte Nächstenliebe und kündigte das Reich Gottes an. Seit jeher beschäftigt sich der Mensch mit seinesgleichen. Er fragt nach seiner Herkunft und seiner Bestimmung ebenso wie nach einem Sinn des Lebens und seinem Platz in diesem. Die Religion versucht, diese elementaren Fragen zu beantworten und somit den Menschen das Leben leichter, ja erträglicher zu machen. Schon im alten Testament, der gemeinsamen Quelle von Judentum und Christentum, versuchte man den Menschen zu verorten, ihm eine besondere Position zukommen zu lassen. Er gilt als Krone der Schöpfung, ist nach dem Bilde Gottes geschaffen und hat einen Herrschaftsauftrag über die Schöpfung, über alle Tiere, über Land (und alles was darauf wächst) verliehen bekommen. Kant bezeichnete die Frage, 'Was ist der Mensch?', sogar als eine der vier Grundfragen der Philosophie. Die Wurzeln einer solchen Fragestellung kann man folglich schon viel früher in der Geschichte finden, vor dem Entstehen des Christentums. Aristoteles war der erste, der das Menschsein von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtete, obwohl das Wort Anthropologie in der Antike noch nicht bekannt war. Er definierte den Menschen als vollkommenstes aller Lebewesen und sah seine Sonderstellung in der Sprache und der Vernunft begründet (ebenso waren das Lachen und der aufrechte Gang spezifisch menschliche Eigenschaften). Diese Auffassung prägte das christliche Mittelalter entscheidend. Henri Bergson fasste den Menschen als homo faber auf, also als ein Wesen, welches seine Umwelt durch seine Fähigkeiten unter Kontrolle hat (vgl. Scheler 1914: 340). Der Philosoph und Soziologe Max Scheler sieht jedoch im homo faber nur einen Menschen zweiter Klasse. Obwohl schon zu Lebzeiten in der philosophisch interessierten Öffentlichkeit enorm anerkannt - Heidegger bezeichnete ihn als die stärkste philosophische Kraft der Gegenwart - galt Scheler auf seinem Gebiet immer als Philosoph zweiter Wahl (vgl. Sander 2002: 9).