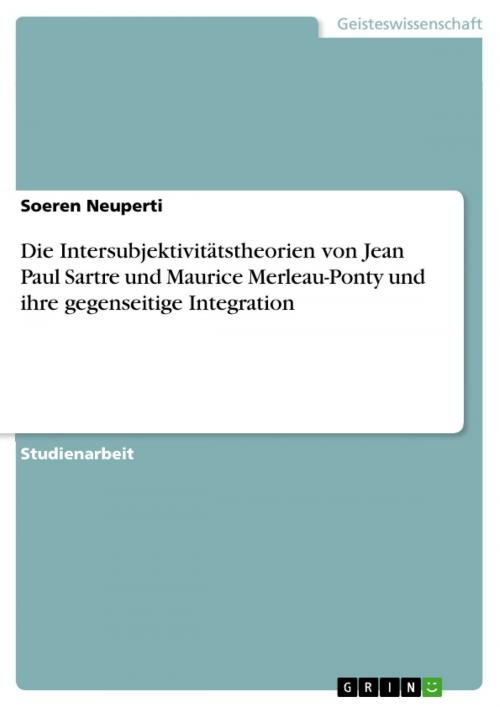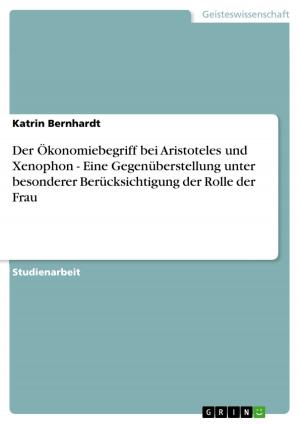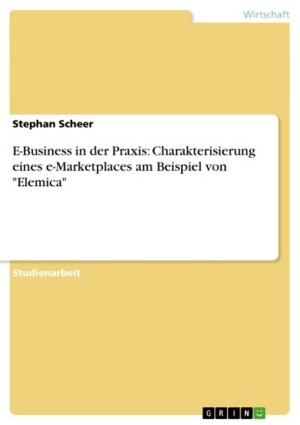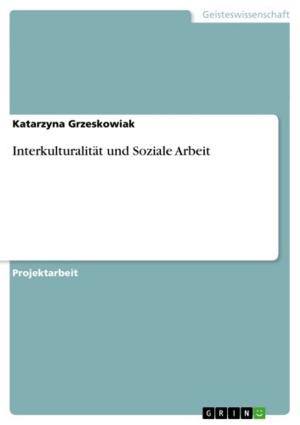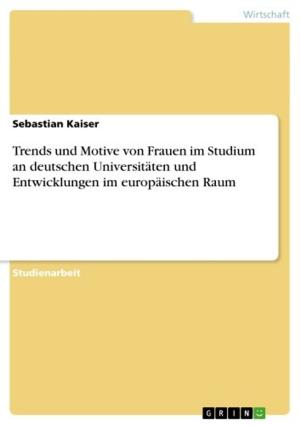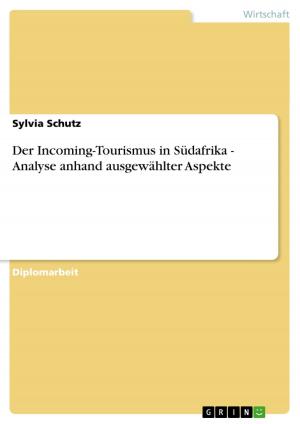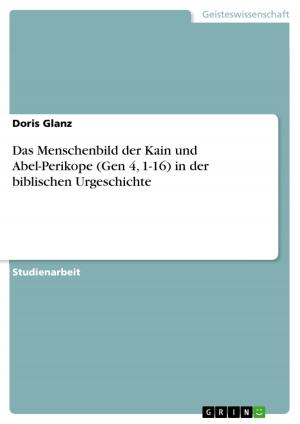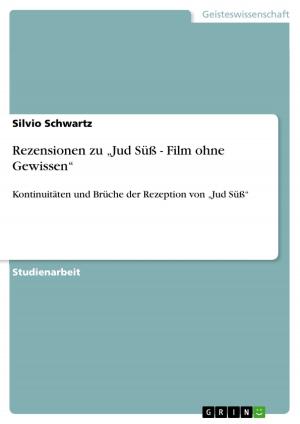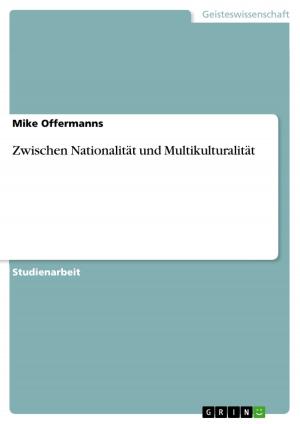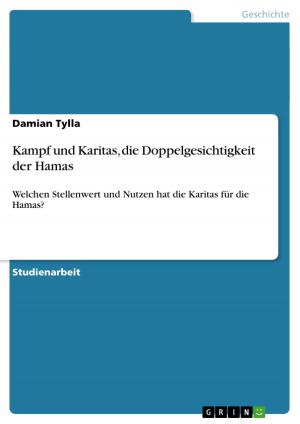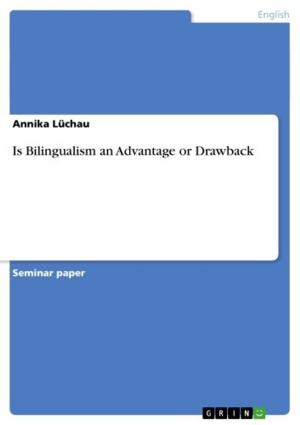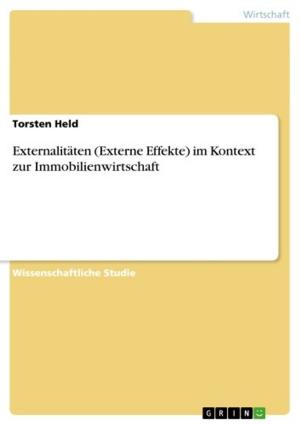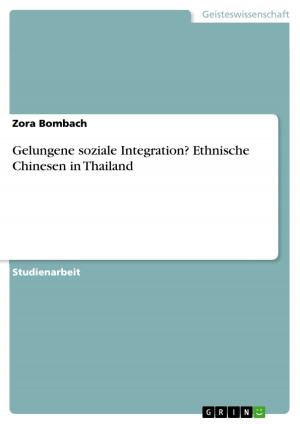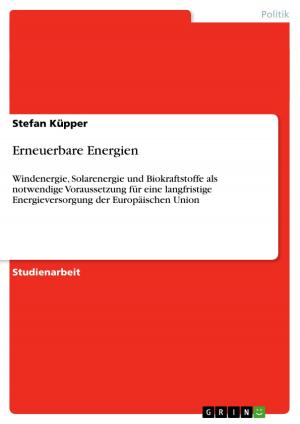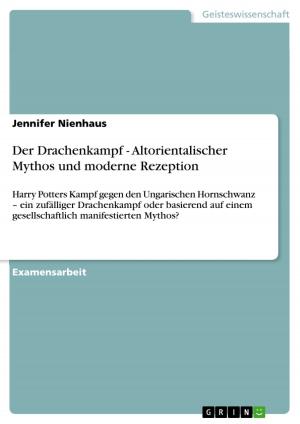Die Intersubjektivitätstheorien von Jean Paul Sartre und Maurice Merleau-Ponty und ihre gegenseitige Integration
Nonfiction, Religion & Spirituality, Philosophy| Author: | Soeren Neuperti | ISBN: | 9783638126625 |
| Publisher: | GRIN Verlag | Publication: | May 16, 2002 |
| Imprint: | GRIN Verlag | Language: | German |
| Author: | Soeren Neuperti |
| ISBN: | 9783638126625 |
| Publisher: | GRIN Verlag |
| Publication: | May 16, 2002 |
| Imprint: | GRIN Verlag |
| Language: | German |
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Philosophie - Theoretische (Erkenntnis, Wissenschaft, Logik, Sprache), Note: 1-, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Institut für Philosophie), Veranstaltung: Grundbegriffe der Phänomenologie des Sozialen und der Politik, Sprache: Deutsch, Abstract: 'Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst.' (Ernst Bloch) Der Andere war uns -philosophiegeschichtlich besehen - lange kein Problem. In der Antike fand sich der Mensch in einem geordneten Kosmos immer schon vergemeinschaftet vor. Das Sein wurde vom Kosmos her gedacht, unter dessen Dach sich alle Menschen zunächst als 'Wir' und erst dann als 'Ich' fanden. Der Mensch war in der Antike zwar sozialethisch, nicht jedoch sozialontologisch problematisch. Auch wenn das Christentum den Kosmos als Schöpfer in seiner Anschauung durch den personalen transzendenten Dritten, d.i. Gott, ersetzt, bleibt der Andere den Menschen vertraut. Schließlich sind alle Menschen Mitgeschöpfe in Gottes Schöpfung und somit eo ipso in ihrem Verhältnis zur Welt und den Anderen unerschüttert. Auch der strenge Rationalismus Descartes' mit seinem Cogito kann das 'Problem des Anderen' nicht in vollem Umfang lösen. Die Stützen seines Denkens verschärfen es vielmehr. Denn durch Descartes Trennung des Seins in zwei heterogene Wirklichkeitsbereiche, der 'res extensa' und 'res cogitans', kam nicht nur die Frage auf, wie die Verknüpfung beider heterogenen Wirklichkeitsbereiche -also der Bezug des Menschen zu den Dingen- möglich sei. Vielmehr war mit dieser cartesianischen Unterscheidung auch schon eine Spaltung innerhalb des Subjektes vorweggenommen. Eben weil der Mensch zugleich fühlend, wahrnehmend, handelnd, also seelisch und gefühlt, wahrgenomme ist. Hegel hat diese Ambiguität des Subjekts explizit thematisiert: 'Das Selbstbewusstsein ist an und für-sich, indem und dadurch, dass es für ein anderes (Selbstbewusstsein) an und für sich ist; d.h. es ist nur als ein Anerkanntes'. Die Aussage Hegels könnte man als den Beginn intersubjektivistischen Denkens bezeichnen, denn es ist eben dieses Paradox innerhalb des Subjektes, das zugleich für-sich und an-sich ist, das maßgeblich dafür ist, dass uns der Andere sozio-ontologisch zum Problem und dadurch zugleich zu einem der Hauptthemen der Philosophie des 20. Jahrhunderts wird. Dabei ist die Grundfrage jeder Intersubjektivitätstheorie im Grunde ethisch bestimmt. Es geht darum, den Solipsismus zu überwinden, jene Theorie, die das ganze Sein mit dem eigenen Bewusstsein gleichsetzt und damit neben diesem kein anderes zulässt. Denn nur, wenn man zu erklären in der Lage ist, wie andere Bewusstseine uns erscheinen können, entgeht man dieser Theorie, und ermöglicht erst eine anschließende Ethik.
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Philosophie - Theoretische (Erkenntnis, Wissenschaft, Logik, Sprache), Note: 1-, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Institut für Philosophie), Veranstaltung: Grundbegriffe der Phänomenologie des Sozialen und der Politik, Sprache: Deutsch, Abstract: 'Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst.' (Ernst Bloch) Der Andere war uns -philosophiegeschichtlich besehen - lange kein Problem. In der Antike fand sich der Mensch in einem geordneten Kosmos immer schon vergemeinschaftet vor. Das Sein wurde vom Kosmos her gedacht, unter dessen Dach sich alle Menschen zunächst als 'Wir' und erst dann als 'Ich' fanden. Der Mensch war in der Antike zwar sozialethisch, nicht jedoch sozialontologisch problematisch. Auch wenn das Christentum den Kosmos als Schöpfer in seiner Anschauung durch den personalen transzendenten Dritten, d.i. Gott, ersetzt, bleibt der Andere den Menschen vertraut. Schließlich sind alle Menschen Mitgeschöpfe in Gottes Schöpfung und somit eo ipso in ihrem Verhältnis zur Welt und den Anderen unerschüttert. Auch der strenge Rationalismus Descartes' mit seinem Cogito kann das 'Problem des Anderen' nicht in vollem Umfang lösen. Die Stützen seines Denkens verschärfen es vielmehr. Denn durch Descartes Trennung des Seins in zwei heterogene Wirklichkeitsbereiche, der 'res extensa' und 'res cogitans', kam nicht nur die Frage auf, wie die Verknüpfung beider heterogenen Wirklichkeitsbereiche -also der Bezug des Menschen zu den Dingen- möglich sei. Vielmehr war mit dieser cartesianischen Unterscheidung auch schon eine Spaltung innerhalb des Subjektes vorweggenommen. Eben weil der Mensch zugleich fühlend, wahrnehmend, handelnd, also seelisch und gefühlt, wahrgenomme ist. Hegel hat diese Ambiguität des Subjekts explizit thematisiert: 'Das Selbstbewusstsein ist an und für-sich, indem und dadurch, dass es für ein anderes (Selbstbewusstsein) an und für sich ist; d.h. es ist nur als ein Anerkanntes'. Die Aussage Hegels könnte man als den Beginn intersubjektivistischen Denkens bezeichnen, denn es ist eben dieses Paradox innerhalb des Subjektes, das zugleich für-sich und an-sich ist, das maßgeblich dafür ist, dass uns der Andere sozio-ontologisch zum Problem und dadurch zugleich zu einem der Hauptthemen der Philosophie des 20. Jahrhunderts wird. Dabei ist die Grundfrage jeder Intersubjektivitätstheorie im Grunde ethisch bestimmt. Es geht darum, den Solipsismus zu überwinden, jene Theorie, die das ganze Sein mit dem eigenen Bewusstsein gleichsetzt und damit neben diesem kein anderes zulässt. Denn nur, wenn man zu erklären in der Lage ist, wie andere Bewusstseine uns erscheinen können, entgeht man dieser Theorie, und ermöglicht erst eine anschließende Ethik.